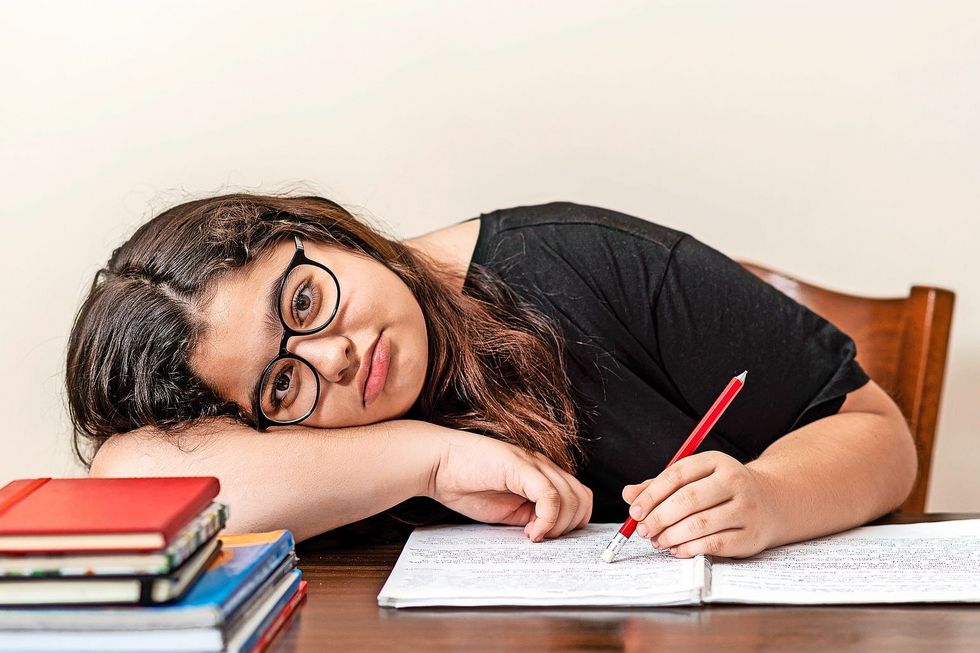Das Max-Planck-Institut für Psychiatrie zeigte 2013, wie sozialer Stress den Körper beeinflussen kann – zumindest bei Mäusen. Stress reduziert im Hippocampus, der zentralen Gehirnregion für das Lernen, die Konzentration des Proteins Homer-1. Dieser Mangel verändert die Aktivität der Nervenzellen und schwächt die Lernfähigkeit der Nager. Beim Menschen vermuten Forschende ähnliche Mechanismen. Bei Mäusen konnte die Zugabe von Homer-1 die Lernschwäche verhindern. Das weckt Hoffnung, dass sich stressbedingte Lernprobleme auch bei Menschen eines Tages behandeln lassen.
Blockaden erkennen ist nicht einfach
Für Eltern oder Lehrpersonen ist es oft schwierig, eine Lernblockade zu erkennen. Schülerin Daniela schweigt bei Fragen von Lehrerinnen und Lehrern. Könnte dieses Verhalten auch ein Fall von Prokrastination sein? Oder handelt es sich beim Verweigern der Antwort vielleicht um eine jugendliche Provokation? «Lernblockaden sind in den meisten Fällen mit Angst, Scham und innerlichem Verstummen verbunden», sagt Fachfrau Straub.
Provokation würde anders aussehen: Blickkontakt mit der Lehrperson und keine Spur von Scham. Auch Prokrastination passt selten ins Bild einer Lernblockade, denn viele Betroffene – wie Daniela – sind fleissig und haben hohe Ansprüche an sich selbst. Was sie blockiert, sind Angst, Scham und Sorgen. Sie fürchten sich davor, einen Fehler zu machen und deswegen ihrem Umfeld nicht zu genügen.
Wer in einer Blockade steckt, ist nicht handlungsfähig. Deshalb rät Straub Lehrpersonen, betroffenen Schülerinnen und Schülern aus dem Blockade-Setting heraus zu helfen, indem sie eine andere Aktivität anbieten. Malen, Bewegung oder ein Glas Wasser trinken können den Druck mindern. Zusätzlich können gezielte Lernstrategien helfen, Blockaden zu lösen: Strukturen schaffen Vertrauen und Visualisierungstechniken geben Sicherheit.
Mehr Verständnis, weniger Druck
Lehrpersonen haben eine Schlüsselrolle im Umgang mit Lernblockaden. Je gelassener und verständnisvoller sie reagieren, desto leichter fällt es Betroffenen, mit der Situation umzugehen. Verständnis und Vertrauen wirken entlastend. «Lernblockaden sind Teil unseres Schulalltags», sagt Straub. «Dabei handelt es sich aber um eine Momentaufnahme und kein Dauerzustand. Schafft es die Lehrperson, dies zu vermitteln, nimmt das den Betroffenen ungemein viel Druck.»
«Lernblockaden sind Teil unseres Schulalltags.»
Lernblockaden zu ignorieren, führt selten zum Erfolg. Straub vergleicht die Situation mit der Angst, in einen engen Aufzug zu steigen. Am Anfang ist die Angst auf den Lift beschränkt, später auf kleine Räume und schliesslich auf komplette Gebäude. Mit der Zeit bestimmt und limitiert die Angst das Leben der Betroffenen. Genauso kann es sich mit Lernblockaden verhalten. Was mit einer Blockade bei Fragen der Lehrperson beginnt, könnte zu einer Blockade vor Gesprächen und schliesslich vor sozialen Interaktionen führen.
Sinnvoller Selbstschutz
Seit einigen Wochen arbeitet Lerntherapeutin Straub mit der Oberstufenschülerin Daniela. Gespräche und Rollenspiele stehen im Fokus. «Es geht darum klarzustellen: Danielas Verhalten ist nicht schlecht oder falsch», erklärt die Therapeutin. «In bestimmten Situationen ergibt es sogar Sinn.» Wer beispielsweise zu Hause seit frühester Kindheit für kleinste Fehler bestraft wird, vermeidet zum Selbstschutz riskante Situationen und zieht sich zurück – eine sinnvolle Strategie in einer solchen Familie. In der Schule jedoch blockieren sich diese Kinder aus Angst vor Fehlern und können sich somit kaum auf das Lernen einlassen.
«Aber allein die Vorstellung einer Blockadesituation und eines darin nützlichen Verhaltens schafft Vertrauen und gibt ein Gefühl von Sicherheit und Selbstkontrolle.»
Ein weiterer Schritt besteht darin, Sicherheit und Vertrauen aufzubauen. Unzählige Varianten von Reaktionsmustern und möglichen Szenarien werden durchgespielt. Ziel ist es, Lösungsansätze zu finden, die in der Praxis funktionieren. Oft hilft es Betroffenen, zu analysieren, wie sie sonst mit Schwierigkeiten umgehen und welche Möglichkeiten sie bereits kennen, um diese erfolgreich zu meistern. Trotzdem lasse sich das Rollenspiel mit Worst-Case-Szenarien nachher nicht unbedingt in der Realität anwenden, hält Straub fest. «Aber allein die Vorstellung einer Blockadesituation und eines darin nützlichen Verhaltens schafft Vertrauen und gibt ein Gefühl von Sicherheit und Selbstkontrolle.»
Strategien entwickeln
Danielas Lernblockade belastet sie daheim nicht, da sie hier auf ihre Mutter vertrauen kann. Ist diese anwesend, ist das Beantworten von Fragen kaum ein Problem. In der Schule jedoch sucht sie vergeblich nach einer solchen Unterstützung. Stattdessen endet die Situation oft mit einem Blick zu kichernden Freundinnen und der Konfrontation mit der genervten Lehrperson.
In Rollenspielen arbeitet die Jugendliche nun daran, auch für solche Situationen eine Strategie zu finden, um ihre Blockade zu überwinden. Die Zeit drängt, denn Daniela befindet sich mitten in der Berufswahl. Dazu gehören auch Anrufe bei Lehrbetrieben und das spontane Beantworten von Fragen.
In genau diesen Situationen hat Daniela ihre ersten Erfolgserlebnisse verbucht. Sie kann während den Telefongesprächen Fragen problemlos beantworten. Das Erfolgsrezept? Bei den Telefonaten sitzt beispielsweise Danielas Mutter im Hintergrund. Droht Angst und Unsicherheit überhandzunehmen, reicht der 12-Jährigen ein kurzer Blick zu ihrer Vertrauensperson. Daniela fühlt sich gestärkt – und bleibt frei von Blockaden.