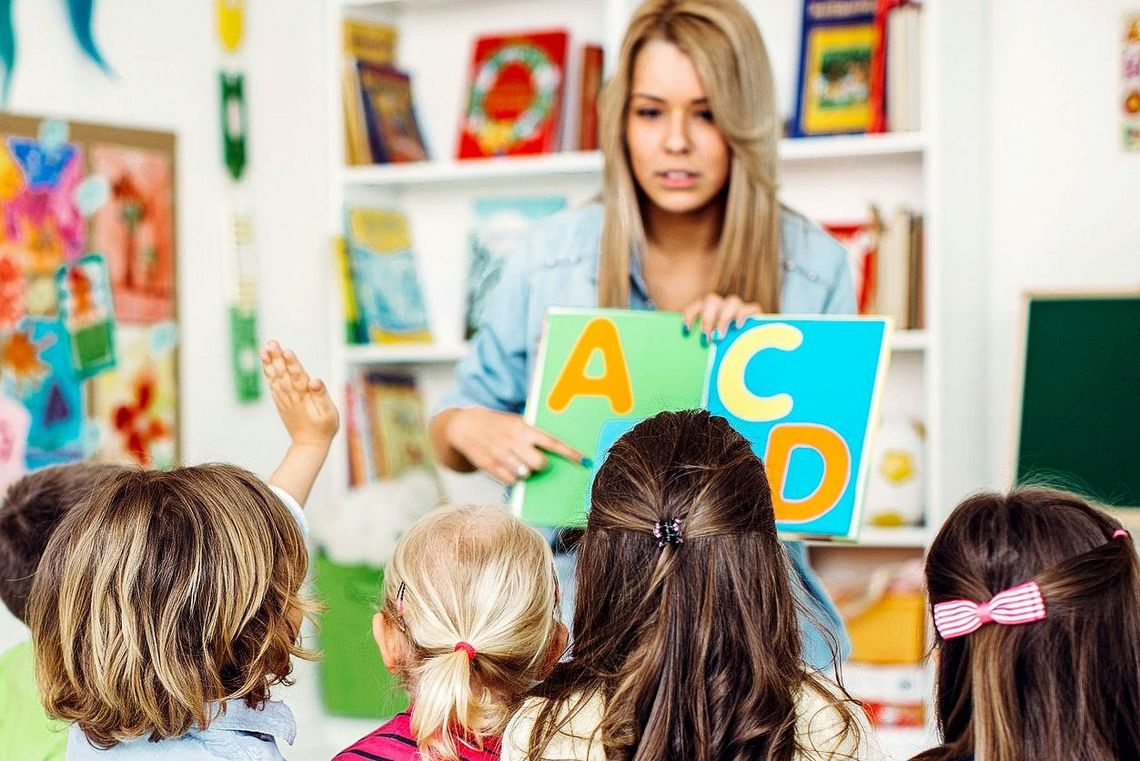1273 Haushalte in der Stadt Bern haben Anfang 2024 einen Brief vom städtischen Gesundheitsdienst erhalten. Es sind Familien, deren Kinder im Sommer 2025 in den Kindergarten kommen. Darunter sind solche, die eine andere Muttersprache als Deutsch sprechen. Zum fünften Mal in Folge hat Bern für sie das Angebot «Deutsch lernen vor dem Kindergarten» lanciert. Denn: «Wir möchten, dass alle Kinder die bestmöglichen Chancen in der Schule haben. Dafür sind gute Deutschkenntnisse sehr wichtig», sagt Eliza Spirig, Leiterin des Frühförderangebots «Primano».
Der Brief enthielt auch in diesem Jahr eine Elternbroschüre und einen Begleitbrief mit einem persönlichen Zugangscode zu einem Online-Fragebogen. Dieser liegt in vierzehn Sprachen vor. Damit können Eltern die Deutschkenntnisse ihres Kindes jeweils selbst einschätzen. Ergibt die Auswertung des Fragebogens, dass eine Sprachförderung nötig ist, wird den Eltern empfohlen, ihr Kind für zwei Tage pro Woche in einer Kindertagesstätte anzumelden oder für zwei Halbtage pro Woche in eine Spielgruppe zu schicken. Möglich ist auch eine Kombination mit einem Mutter-Kind-Deutschkurs. Im Schnitt wird bei einem Viertel der Kinder Förderbedarf festgestellt.
«Es kann nicht sein, dass 25 Prozent der Schulkinder Analphabeten sind.»
«Ziel ist es, die Kinder mit Förderbedarf in einer Gruppe in Alltagssituationen die deutsche Sprache erleben und lernen zu lassen», sagt Spirig. Ob beim Tischdecken in der Kita, beim Znüniessen in der Spielgruppe, beim Schuhe An- und Ausziehen oder ganz einfach beim Spielen: Der Tagesablauf in der Kita oder Spielgruppe hält viele Momente bereit, in denen der Wortschatz der Kinder erweitert und eine gezielte, sprachliche Förderung vorgenommen werden kann.
Sprache ist wichtig für Bildungserfolg
Die Sprache gilt als einer der wichtigsten Schlüssel für den Bildungserfolg. Wer im Vorschulalter nicht über einen ausreichenden, deutschen Wortschatz der Lokalsprache verfügt, wird mit einem sprachlichen Rückstand eingeschult. Diesen im Verlauf der Schulzeit aufzuholen, ist schwierig. Ein sprachlicher Rückstand kann sich unter anderem negativ auf die Lesekompetenz auswirken, die für ein erfolgreiches Lernen wichtig ist. Denn: «Lesen ist unser wichtigstes Instrumentarium beim Aufbau analytischen und kritischen Denkens», sagt Carl Bossard, Gründungsrektor der pädagogischen Hochschule Zug auf Nachfrage. Er äussert sich immer wieder dezidiert zum Thema.
Wie es um diese Lesekompetenz steht, hat die aktuelle Pisa-Studie aufgezeigt: Ein Viertel der Schülerinnen und Schüler gilt in diesem Bereich als leistungsschwach. Das heisst, sie sind nicht in der Lage, einen Text zu verstehen. «Es kann doch nicht sein, dass 25 Prozent der Schulkinder funktionelle Analphabeten sind. Das ist ein Systemversagen», so Bossard.
Die Frühförderung soll es richten
Mit der sprachlichen Frühförderung will man den negativen Auswirkungen fehlender Sprachkenntnisse entgegentreten: Je früher Kinder, die eine andere Muttersprache als die lokale sprechen, Deutsch lernen, desto geringer fällt ihr Defizit bei der Einschulung aus. So zumindest das Fazit diverser Studien.