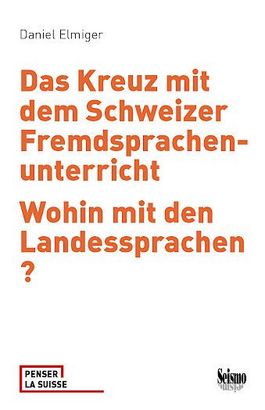Die Mehrsprachigkeit ist ein zentrales Identitätsmerkmal der Schweiz und bildet die Grundlage für den nationalen Zusammenhalt. Doch wie steht es tatsächlich um die Fremdsprachen an unseren Schulen? Das Buch «Das Kreuz mit dem Schweizer Fremdsprachenunterricht» von Daniel Elmiger liefert eine fundierte Bestandsaufnahme, die für die laufende bildungspolitische Diskussion von grosser Relevanz ist. Elmiger beleuchtet die Diskrepanz zwischen den hehren Zielen und der oft unbefriedigenden Realität des Sprachenlernens in der Schweiz. Das Buch hinterfragt die Effektivität des Systems und regt eine Diskussion über Ziele und Lösungen an.
Bedeutungsverlust der Landessprachen
Elmiger ist Sprachwissenschaftler und Didaktiker an der Universität Genf. Er führte eine umfassende Analyse des Schweizer Fremdsprachenunterrichts durch. Seine zentrale These ist unmissverständlich: «In der Schweiz steht es mit den Landessprachen nicht zum Besten.» Deutsch, Französisch, Italienisch und Rätoromanisch verlören ausserhalb ihrer jeweiligen Sprachgebiete zunehmend an Bedeutung. Das traditionelle Schweizer Modell nach dem Prinzip «chacun à sa langue» weicht zunehmend Englisch als Lingua franca. Der Autor belegt dies mit Statistiken zu Sprachgebrauch und Motivation. Es komme so zu einer Diskrepanz zwischen dem idealisierten Bild der viersprachigen Schweiz und der gelebten Realität.
Elmiger plädiert dafür, Sprachen authentisch erlebbar zu machen.